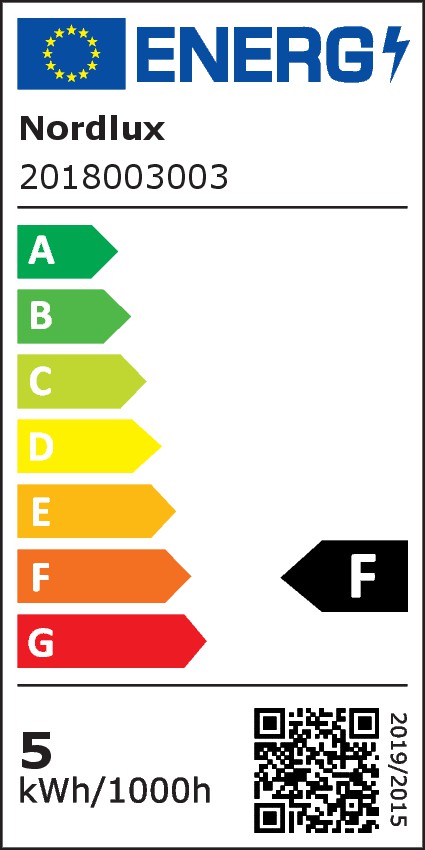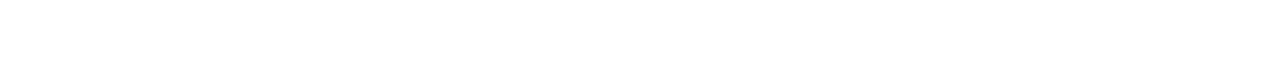Karbidlampen existieren seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und wurden vor allem an Zügen, Autos und Fahrrädern genutzt. Karbidlampen boten den Vorteil, dass sie einen vergleichsweise hellen und weit scheinenden Lichtkegel erzeugen konnten und dabei festen Brennstoff nutzen konnten. Erst die Glühbirne machte ihnen Konkurrenz, konnte sie aber nicht gänzlich vom Markt verdrängen.
Karbidlampen existieren seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und wurden vor allem an Zügen, Autos und Fahrrädern genutzt. Karbidlampen boten den Vorteil, dass sie einen vergleichsweise hellen und weit scheinenden Lichtkegel erzeugen konnten und dabei festen Brennstoff nutzen konnten. Erst die Glühbirne machte ihnen Konkurrenz, konnte sie aber nicht gänzlich vom Markt verdrängen.
Eine Karbidlampe ist in zwei Kammern unterteilt. In der unteren liegt der Brennstoff Calciumcarbid, in der oberen befindet sich Wasser. Dieses tropft auf das Calciumcarbid, welches damit chemisch reagiert. Infolgedessen entsteht Acetylen, ein leicht brennbares Gas sowie gelöschter Kalk. Der Kalk verbleibt in der unteren Kammer, das Gas strömt zu einem Brenner und erzeugt eine Flamme, die für die Beleuchtung sorgt. Dabei befindet sich hinter der Flamme ein Parabolspiegel, der die Lichtausbeute erhöht und den Lichtkegel fokussiert.
Im Straßenverkehr wurden Karbidlampen noch bis in die 1950er Jahre verwendet. In der Höhlenforschung werden sie noch bis heute eingesetzt. Hier ist es vor allem die leichte Wartung, die den Einsatz weiterhin rechtfertigt. Probleme können in der Regel vor Ort gelöst werden und die Flamme erzeugt zudem etwas Wärme. Außerdem können Karbidlampen einen sehr breiten Lichtschein erzeugen und damit große Teile einer Höhle ausleuchten. Erst neueste LED-Techniken ermöglichen ähnliche Ausleuchtungsgrade und fangen somit an, die Karbidlampe beispielsweise durch LED Kopflampen zu ersetzen. Dennoch ist sie hier noch weit verbreitet und wurde entsprechend über die Jahre weiterentwickelt: Die beiden Kammern mit Calciumcarbid und Wasser werden mittlerweile in der Regel am Gürtel befestigt. Ein Schlauch leitet von dort das Gas zum Brenner, der am Helm befestigt ist und als Stirnlampe fungiert.